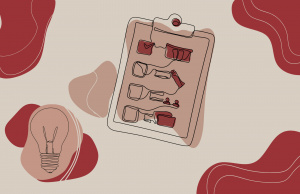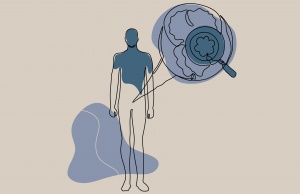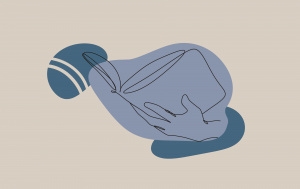hiemssmeih
Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Wien
Obere Augartenstraße 26-28
1020 Wien
Kontaktperson:
Obmann Leopold Pecenka
Tel: 01 3331010
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Website: https://www.prostatakrebse.at/
Lena Mitterhauser
- Studentin (BSc Pferdewissenschaften und BA Soziale Arbeit, Tiertrainerin in Ausbildung)
- Zuständig für die PatioSpots-App
- Konzeption und Weiterentwicklung der App, sowie Eintragungen der verschiedenen Spots
Univ.-Prof. Dr. Markus Mitterhauser
- Universitätsprofessor für Applied Diagnostics
- Projektverantwortlicher bei PATIO
- Funding, Entwicklung, Interaktion
Sanja Moldovan, MSc
Jonas Winter, BSc
- BSc in Medizinischer Biologie
- Student (MSc Neuroscience)
- Redaktionelle Tätigkeit bei PATIO
- Recherche, Strukturierung und Gestaltung der Website-Inhalte
Vorbereitung zur radikalen Prostatektomie (RALP)
Was du zu deiner Prostatektomie mitnehmen solltest und wie du dich vorbereiten kannst
Hat der Tumor ein bestimmtes Stadium erreicht, scheint nicht selten die Prostatektomie - also die chirurgische Entfernung der Prostata - als chancenversprechendste Maßnahme zur Tumorfreiheit, hoffentlich bis zum Lebensende. Viele Betroffene erwägen diesen Schritt verständlicherweise mit viel Vorsicht, nicht zuletzt aus Respekt vor dem chirurgischen Eingriff selbst. Während auf die Notwendigkeit einer solchen Operation und damit möglicherweise einhergehende Nebenwirkungen leider niemand Einfluss nehmen kann, sollte man jedoch sehr wohl sicherstellen, die Zeit im Krankenhaus so angenehm wie möglich zu gestalten.
Wir haben das Gespräch mit Betroffenen gesucht, die diesen Eingriff bereits hinter sich haben und von ihnen viele wertvolle Ratschläge darüber erhalten, welche Gegenstände und sonstigen Vorbereitungen den bestmöglichen Komfort während Deines Aufenthalts im Krankenhaus garantieren und welche praktischen Lösungen bei so mancher Komplikation helfen können. Mit diesen Tipps aus erster Hand wirst also bestimmt auch Du für Deine OP vorbereitet sein und die Tage danach durchstehen!
Disclaimer: Im Text sind bestimmte Begriffe gelegentlich mit einem Link versehen, der zu einem Amazon-Link führt, um eine Vorstellung zu geben, was unter den genannten Dingen in etwa gemeint ist. Uns ist allerdings wichtig, anzumerken, dass die konkreten Artikel nicht von uns getestet wurden und wir für das Integrieren der Links auch in keiner Weise finanziell profitieren.
1 Alles rund um den Katheter
- Katheterschlauch zurechtrücken
- Katheter-Tragebeutel
- K-Y Jelly Gel
- Seite des Katheters ausrichten
- Die passende Hose / Nachthemd
- Schmerzen anmerken
Die häufigsten Beschwerden, von denen Betroffene erzählen, stehen in Zusammenhang mit dem Katheter, der nach bzw. während der OP angelegt wird. Liegt er schlecht, kann das auf Dauer zu sehr intensiven Schmerzen führen. Dabei sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Denn es ist meistens vermeidbar. Grundsätzlich gilt als besonders wichtig, zu vermeiden, mit dem Katheter anzustoßen bzw. am Katheterschlauch zu ziehen. Für diesen Zweck eignen sich insbesondere eigens dafür vorgesehene Tragebeutel, worin man den Katheter sicher legen und mittragen kann, wenn man ein paar Schritte gehen möchte. Alternativ dazu kannst Du Klebeband mitnehmen und ihn damit an Dein Bein binden bzw. Befestigungspflaster, die Du auf jeder urologischen Station bekommst, dafür nutzen. Im Prinzip ist dabei lediglich wichtig, dass der Schlauch des Katheters in einer kleinen Schleife anstatt in direkter Linie zum Penis hängt. Sicherheitshalber kannst Du auch ein K-Y-Jelly-Gel mitnehmen, falls diesbezüglich Komplikationen auftreten sollten. Ebenfalls ratsam ist an dieser Stelle, den Katheter bereits am ersten Tag gemeinsam mit der Krankenschwester an die bevorzugte Seite des Betts zu fixieren. Abhängig von deiner Schlafposition - insbesondere für Seitenschläfer - kann die Wahl der richtigen Seite ausschlaggebend für Deinen erholsamen Schlaf sein.
Darüber hinaus ist der Katheter normalerweise eher hinderlich, wenn es darum geht, seine Kleidung zu wechseln bzw. überhaupt etwas anderes zu tragen als das klinische OP-Nachthemd. Insofern ist es ratsam, sich bereits im Vorhinein Gedanken darüber zu machen. Als Alternative bieten sich hierbei zum Beispiel speziell dafür vorgesehene OP-Rehabilitations-Hosen mit Knöpfen an den Seiten oder ein eigenes, bequemes Nachthemd an.
Falls trotz allem an irgendeinem Zeitpunkt deines Aufenthalts Schmerzen auftauchen, zögere nicht, das in Anwesenheit der Krankenpfleger:innen anzumerken. Auf lange Sicht kann das ansonsten äußerst schmerzhaft werden, obwohl es eigentlich fast immer Lösungen gibt, um das zu reduzieren oder gar zu verhindern. So erzählt zum Beispiel ein Patient, die natürliche Form seines Glieds hätte durch das Befestigen des Katheters auf der falschen Seite einen internen Knick ausgelöst, der infolgedessen den Urinabfluss unmöglich machte. Das Problem konnte er folglich lösen, indem er die Seite wechselte. Nicht zuletzt zählt auch ein undichter Katheter zu den Routine-Problemen des Stationsaufenthalts. Das kann entweder, wenn auch eher selten, an einem verstopften Katheter oder aber an Blasenkrämpfen liegen, gegen die man anschließend ein Medikament bekommt. Übermäßige Schmerzen sind also niemals notwendig und sollten unbedingt thematisiert und behandelt werden.
2 Gegenstände fürs Wohlbefinden
- Wärmekissen & Massagegerät für Rücken, Bauch und Schultern
- Hustenbonbons
- Extra-Polster
- Extra gepolsterte Unterhosen
Hast Du die OP erstmal bestanden, gilt: Geduld! Der menschliche Körper ist äußerst erholungsfähig, aber ein bisschen Zeit musst Du ihm trotzdem lassen. Spätestens nach einer Woche solltest Du Dich schon wesentlich besser fühlen. Lehn Dich also zurück und mach es Dir so bequem wie möglich - Dein Körper macht von hier weg die Arbeit für Dich. Vielleicht hast Du ja ein Wärmekissen oder ein Massagegerät, das Dir das übermäßige Liegen am Krankenbett erleichtert und angenehmer macht.
Es ist definitiv auch kein Fehler, sich infolge der OP sicherheitshalber auf eine Husteninfektion vorzubereiten. Egal, ob das die Folge der physischen Belastung der Narkose oder einfacher Raucherhusten ist: jegliche plötzliche Kontraktionen im Bauchbereich sind in der Situation äußerst unangenehm. In diesem Fall bewirken Hustenbonbons bereits Wunder. Dasselbe gilt übrigens auch für Lachen, Niesen und dergleichen. Hierfür kannst Du Dir auch einen zusätzlichen Polster mitnehmen, den Du dann auf Deine Schnittseite hältst, damit sie nicht weh tut. Ergänzend dazu sorgen sicherlich auch bepolsterte Unterhosen für mehr Komfort am Krankenbett.
3 Gegenstandslos (Mentale und körperliche Gesundheit)
- Seelische Unterstützung mitnehmen
- Mental darauf einstellen (Schwierigkeiten mit Stuhlgang)
- Geduld, für Pathologie-Ergebnisse (Dinge für Zeitvertreib)
- Schmerzmittel vermeiden
- Beckenbodentraining zur Kontinenzverbesserung
- Bewegung durch Spazierengehen
Die wohl wichtigste Vorbereitung für die Prostatektomie ist, sich mental darauf einzustellen. In den Stunden vor der OP verdichten sich Zweifel und Aufregung in deinem Kopf. Es ist absolut in Ordnung, sich Gedanken über mögliche Nebenwirkungen etc. zu machen. Überschreiten Deine Gefühle jedoch die Schwelle zur Panik und es entsteht plötzlich eine große Unsicherheit über den bevorstehenden Eingriff, solltest Du die Besorgnis dringend einer Krankenschwester oder eine:m Arzt oder Ärztin gegenüber äußern. Ob Nervosität oder mehr als das: In jedem Fall ist es angenehm, seelische Unterstützung zur OP, optimalerweise sogar zum OP-Gespräch mitzunehmen. Häufig begleiten also ein:e Lebensgefährt:in oder ein:e Freund:in den Patienten in dieser teilweise sehr fordernden Zeit, um den entscheidenden Unterschied von Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit zu Wohlgefühl und Zuversicht auszumachen.
Aber auch in den Wochen und Monaten nach Deinem Krankenhausaufenthalt ist seelische Unterstützung sehr wichtig. Es braucht oft seine Zeit, ehe mögliche Beschwerden wie Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang nachlassen und sich die allgemeine Situation verbessert. Zusätzlich zur unterstützenden Hand seiner Liebsten ist es daher auch ratsam, bereits im Vorhinein Kontakt zu anderen Betroffenen oder einer Selbsthilfegruppe aufzunehmen, um sich zu jedem Zeitpunkt über Erfahrungen auszutauschen. Hier erhältst Du häufig auch sehr wertvolle Tipps zu sehr spezifischen Problemen wie dem richtigen Umgang mit Schmerzmitteln, die unter Umständen suchtauslösend wirken können und im Optimalfall ausschließlich für Schlaf genutzt werden sollten.
Ebenso sollte Dir als Patient bewusst sein, dass die Zeit nach der OP neben der physischen und körperlichen Belastung auch viel psychische Ausdauer erfordert. Denn bis Du erfährst, ob der Eingriff wirklich erfolgreich war, kann über eine Woche vergehen. Während also Dein Körper langsam verheilt, wächst nicht selten der emotionale Stress in deinem Kopf. Es ist demnach sehr wichtig, sich bereits im Vorhinein Gedanken darüber zu machen, wie man sich während dieser Geduld fordernden Zeit am besten selbst beschäftigen kann, solange man auf die Pathologie-Ergebnisse wartet.
Abschließend kommen wir noch zu dem wohl einfachsten und gleichzeitig dennoch effizientesten Trick: Bereite Dich auf Deine OP vor, indem Du jeden Tag gehst oder Dich anderweitig bewegst. Fitness ist ein sehr essentieller Teil der Genesung. Gewöhne Dir bereits zuvor einen kurzen täglichen Spaziergang an, den Du dann nach Deiner Prostatektomie fortführst. Idealerweise erweiterst Du Deine sportliche Betätigung mit aerobem-, Kraft- und insbesondere Beckenbodentraining. Frage hier am besten bei deiner Ärztin oder deinem Arzt nach einer Empfehlung für eine:n Beckenboden-Trainer:in; oft gibt es dazu auch Angebot im ansässigen Krankenhaus. Dadurch kannst du bereits vor OP-Antritt nachweislich sowohl deine Kontinenz als auch den Verlauf des Eingriffs verbessern, da sich Dein Körper wesentlich schneller regeneriert. Auch ein Rauchverzicht in den Wochen vor der OP kann den Heilungsprozess beschleunigen.
Nun, selbstverständlich wirst Du unmittelbar nach Deinem Eingriff kaum die Energie haben, Dich viel zu bewegen. Es genügt daher vollkommen eine kleine Runde innerhalb der Krankenstation. Die Gesunden- und Krankenpfleger:innen freuen sich bestimmt, Dich munter anzutreffen. Vielleicht holst Du Dir einen Kaffee oder schaust einfach mal in den Garten. Auch von ärztlicher Seite wird stets zu ausreichender Bewegung, im Optimalfall bereits am ersten Tag nach der OP, geraten. Denn der gesundheitliche Aufschwung vieler bewegungsfreudiger Patienten zeigt, dass jenes bisschen Bewegung maßgeblich zu einer angenehmen physischen sowie psychischen Gesundheit beiträgt, weswegen bewegende Betätigung jedem empfohlen wird, der sich dazu nach seiner OP in der Lage fühlt.
Wichtig: Wir von PATIO sind darum bemüht, unsere Informationen zu prüfen und mit Expert:innen abzusichern. So erfolgte die Freigabe der Texte durch Dr. Melanie Hassler von der MedUni Wien. Dennoch dienen Artikel auf patiospots.com ausschließlich zur Informationsübermittlung und ersetzen kein Ärztinnengespräch. Jeder Prostatakrebs muss individuell betrachtet und ärztlich abgeklärt werden.
Quellen:
Active Surveillance - die wohl kontraintuitivste Behandlung für Prostatakrebs
Du bist im Rahmen Deiner Internetrecherche oder in einem persönlichen Gespräch auf den durchaus auffallenden Begriff „active surveillance“ gestoßen und daran interessiert, mehr darüber zu erfahren? Dann bist Du in diesem Artikel genau richtig! Im Folgenden erfährst Du, was es mit dieser Methode auf sich hat, warum sie auf erstem Blick fast schon verrückt erscheint und unter welchen Bedingungen sie überhaupt infrage kommt.
Was ist “active surveillance”?
„Active surveillance“ ist Englisch und bedeutet übersetzt ganz ernüchternd „Aktive Überwachung“. Im klinischen Kontext versteht man darunter ein Behandlungskonzept von Patienten mit Prostatakrebs, bei der man lediglich in regelmäßigen Abständen (etwa alle drei Monate) den PSA-Wert kontrolliert, der Aufschluss über die Veränderung der Prostata gibt. Ist dieser Wert niedrig oder unauffällig, so ist bis zur darauf folgenden Kontrolle keine weitere Behandlung notwendig. Für den Fall, dass ein auffälliger Schwellenwert überschritten wird (indem sich zum Beispiel der übliche PSA-Wert verdoppelt) oder ein Patient die aktive Überwachung aus anderen Gründen abbrechen möchte, stehen ihm nach genauer Untersuchung Möglichkeiten zur Wahl, die einen Eingriff und/oder eine Behandlung erfordern, wie eine Prostatektomie, aber auch Hormon- oder Strahlentherapie.
Warum entscheidet man sich dagegen, den Tumor direkt zu bekämpfen?
Jetzt fragst Du Dich bestimmt: „Ist das denn überhaupt nicht fahrlässig, seinen Tumor jahrelang nur zu beobachten, ohne ihn zu bekämpfen?“ An diesem Punkt muss gesagt sein: Deine Skepsis ist durchaus berechtigt! Folgt man seiner Intuition, so fühlt sich das in der Tat wenig zielführend an. Warum ist die “active surveillance” dennoch eine der beliebtesten Behandlungen für Betroffene?
Ganz einfach: um zu verhindern, dass einer Person voreilig ihre Prostata entnommen wird oder um die Nebenwirkungen einer Strahlen- oder Hormontherapie zu vermeiden. Denn Fakt ist: Wer seinen Prostatakrebs bekämpft, verliert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch Teile seiner Prostatafunktion. Indem eine Prostatektomie hinausgezögert oder gar verhindert werden kann, ist die aktive Überwachung also die beste Option, um seine Sexualfunktion sowie Kontinenz zu bewahren.
Was nämlich viele gar nicht wissen, ist, dass der Tumor bei 60% der Patienten selbst nach acht Jahren noch kein signifikantes Wachstum zeigt. Und für den Fall, dass jener doch wächst und ein gefährliches Ausmaß annimmt, ist immer noch eine Prostatektomie möglich. Ohne dem Krebs seine Gefährlichkeit absprechen zu wollen, muss man dennoch feststellen, dass sich die “active surveillance” als sichere und erfolgreiche Methode erwiesen hat und insofern weitaus weniger riskant ist, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
Kurz gesagt: Ein Patient entscheidet sich zugunsten seiner Lebensqualität dafür, den Krebs - und damit auch seine Prostata möglichst lange zu behalten, muss allerdings bei jedem Kontrolltermin mit der Angst leben, potentiell negative Nachrichten erhalten zu können.
Für welche Patienten kommt die “active surveillance” nun infrage?
Voraussetzung für die aktive Überwachung ist die Verlässlichkeit des Patienten, regelmäßig zu den vereinbarten Terminen zu erscheinen, ein Tumorstadium von cT1 oder cT2a, ein PSA-Wert kleiner als 10 sowie ein Gleason-Score kleiner oder gleich 6, aber auch, dass die Gewebeprobe einer Stanzbiopsie maximal zur Hälfte aus Tumorzellen besteht und lediglich zwei von 12 Biopsien überhaupt Krebszellen enthalten.
Grundsätzlich sind das jedoch nur Empfehlungen. Denn die ausschlaggebende Entscheidung liegt letzten Endes immer bei den Patienten selbst. Wie schon oben erwähnt, trägt die aktive Überwachung nicht gerade zur Gewissheit bei, den Krebs besiegt zu haben. Für viele Betroffene kann das also sehr belastend sein, weswegen die Entscheidung ausschließlich dann getroffen werden sollte, wenn ein Patient selbst absolut davon überzeugt ist und sich damit sicher und wohl fühlt.
Falls Du Dich selbst in der schwierigen Situation siehst, Dich für oder gegen die “active surveillance” entscheiden zu müssen, kann es hilfreich sein, ein Gespräch mit Deiner persönlichen Onkologin bzw. Deinem Onkologen, Deiner Urologin bzw. Deinem Urologen, Deiner Psychologin bzw. Deinem Psychologen, Familie oder Freunden zu suchen. Auch Kontaktaufnahme zu Selbsthilfegruppen wie www.prostatakrebse.at in Österreich oder prostata-hilfe-deutschland.de in Deutschland können in Fragen wie diesen hilfreich sein und darüber hinaus die Gelegenheit bieten, sich allgemein über ein Leben mit Prostatakrebs auszutauschen.
Wichtig: Wir von PATIO sind darum bemüht, unsere Informationen zu prüfen und mit Expert:innen abzusichern. So erfolgte die Freigabe der Texte durch Dr. Melanie Hassler von der MedUni Wien. Dennoch dienen Artikel auf patiospots.com ausschließlich zur Informationsübermittlung und ersetzen kein Ärztinnengespräch. Jeder Prostatakrebs muss individuell betrachtet und ärztlich abgeklärt werden.
Quellen:
-
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), https://www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/prostatakrebs/therapie/active-surveillance.php (Abruf: 22.9.2022)
-
James R. Broughman, Ramsankar Basak, Matthew E. Nielsen, Bryce B. Reeve, Deborah S. Usinger, Kiayni C. Spearman, Paul A. Godley, Ronald C. Chen; Prostate Cancer Patient Characteristics Associated With a Strong Preference to Preserve Sexual Function and Receipt of Active Surveillance; JNCI Journal of the National Cancer Institute; https://www.researchgate.net/publication/320505728_Prostate_Cancer_Patient_Characteristics_Associated_With_a_Strong_Preference_to_Preserve_Sexual_Function_and_Receipt_of_Active_Surveillance (Abruf: 22.9.2022)
-
J Ryan Russell, M Minhaj Siddiqui; Active surveillance in favorable intermediate risk prostate cancer: outstanding questions and controversies (Abruf: 24.4.2023)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35266907/
Wörterbuch für Prostatakrebs
Für eine flüssige Erklärung ist die Verwendung mancher Fachwörter unvermeidlich und auch Ärzte vergessen gelegentlich, für sie alltägliche - für die breite Bevölkerung jedoch ungewöhnliche - Begriffe genauer zu erklären. Aus diesem Zweck listen wir hier eine Reihe von Begriffen aus dem kleinen Wörterbuch für Betroffene von Prostatakrebs, entnommen aus dem Leitlinienprogramm der Onkologie, auf, um Betroffenen die barrierefreie Kommunikation zu erleichtern.
adjuvant
Bezeichnet im Rahmen einer Krebsbehandlung Maßnahmen, die eine heilende Behandlung unterstützen: zum Beispiel eine zusätzliche Bestrahlung nach der Operation oder eine unterstützende Hormonentzugstherapie während der Bestrahlung.
Afterloading
Anderer Begriff für die Hochdosis-Brachytherapie. Dabei wird eine relativ starke Strahlendosis gezielt auf den Tumor gerichtet. Die Behandlung wird in der Regel zwei- bis dreimal durchgeführt.
akut
Vordringlich, dringend, in diesem Moment.
ambulant
Bei einer ambulanten Behandlung kann der Patient unmittelbar oder kurze Zeit nach Beendigung wieder nach Hause gehen. Er wird nicht stationär aufgenommen.
Anastomosenstriktur
Eine durch Narbenbildung verursachte Verengung am Blasenhals, die unangenehme Probleme beim Wasserlassen verursacht.
Antiandrogene (siehe Artikel "Hormontherapie (ADT)")
Werden bei der Hormonentzugstherapie eingesetzt. Diese Wirkstoffe sorgen dafür, dass das männliche Sexualhormon Testosteron in der Prostata – speziell in den Tumorzellen – nicht wirksam werden kann. Männer, die mit Antiandrogenen behandelt werden, haben einen normalen Testosteronspiegel
Antibiotikum
Medikament, das Bakterien abtötet.
Bestrahlung
Bestrahlung (auch Radiotherapie) beschäftigt sich mit der medizinischen Anwendung von ionisierender Strahlung (zum Beispiel Röntgenstrahlung) auf den Körper, um Krankheiten zu heilen oder deren Fortschreiten zu verzögern. Durch gezielte Behandlung mit radioaktiver Strahlung können verschiedene bösartige Tumoren entweder vollständig zerstört oder in ihrer Entwicklung gehemmt werden.
Biopsie (siehe Artikel "Prostata-Biopsie")
Gewebeprobe. Bei einer Biopsie wird zur Abklärung eines Tumorverdachts Gewebe entnommen, damit es feingeweblich untersucht werden kann. Dies geschieht im Falle einer Prostatabiospie mit Hohlnadeln, die sogenannte Stanzen aus dem Gewebe herausstechen. Brachytherapie Form der Bestrahlung, bei der die Strahlungsquelle in unmittelbare Nähe des zu bestrahlenden Tumors gebracht wird. Man unterscheidet die Niedrig- und die Hochdosisrate-Brachytherapie. Bei beiden Verfahren handelt es sich um einen operativen Eingriff.
Chemotherapie
Bezeichnet die Behandlung von Krankheiten oder Infektionen durch Medikamente. Umgangssprachlich ist jedoch meist die Behandlung von Krebs gemeint. Die Chemotherapie verwendet Stoffe, die möglichst gezielt bestimmte krankheitsverursachende Zellen schädigen, indem sie diese abtöten oder in ihrem Wachstum hemmen. Bei der Behandlung bösartiger Krebserkrankungen nutzen die meisten dieser Stoffe die schnelle Teilungsfähigkeit der Krebszellen, da diese empfindlicher als gesunde Zellen auf Störungen der Zellteilung reagieren. Auf gesunde Zellen mit ähnlich guter Teilungsfähigkeit hat die Chemotherapie allerdings eine ähnliche Wirkung. Sie kann erhebliche Nebenwirkungen wie Haarausfall, Erbrechen oder Durchfall hervorrufen. chronisch Bezeichnet eine Situation oder eine Krankheit, die längere Zeit vorhanden ist und andauert.
Computertomographie
Bei der Computertomographie wird der untersuchte Bereich aus verschiedenen Richtungen geröntgt. Ein Computer verarbeitet die Informationen, die hierbei entstehen, und erzeugt ein räumliches Bild vom untersuchten Organ. Diagnose Durch das sorgsame Untersuchen, Abwägen und Einschätzen aller Krankheitsanzeichen schließt die Ärztin oder der Arzt auf das Vorhandensein und die besondere Ausprägung einer Krankheit.
erektile Dysfunktion
Potenzstörung, Impotenz. Man spricht von einer erektilen Dysfunktion (ED), wenn ein Mann über einen gewissen Zeitraum keine Erektion bekommen oder halten kann. Eine kurzfristige Erektionsstörung wird nicht als ED bezeichnet. extern Außen, äußerlich, von außen kommend.
Fatigue
Bezeichnet eine Begleiterscheinung vieler Krebserkrankungen: Ausgelöst durch die Erkrankung selbst, durch eine Strahlen- oder Chemotherapie kann es zu Zuständen dauerhafter Erschöpfung, Abgeschlagenheit und Überforderung kommen. fraktionieren Bedeutet im Falle einer Bestrahlung, dass die zu verabreichende Gesamtdosis nicht auf einmal gegeben, sondern auf mehrere Sitzungen verteilt wird.
Gleason-Score (siehe Artikel "Gleason-Score")
(Nach dem amerikanische Pathologen Donald F. Gleason) Um zu beurteilen, wie aggressiv ein Prostatakarzinom sein kann, wird der Gleason-Score bestimmt. Dabei untersucht ein Pathologe die entnommenen Gewebeproben und bestimmt das häufigste und das aggressivste Wachstumsmuster der Krebszellen. Zellverbände, die dem normalen Gewebe noch sehr ähnlich sind, haben einen niedrigen Gleason-Grad, Zellverbände, die sich von gesundem Gewebe sehr stark unterscheiden, haben einen hohen (Werte von 1 bis 5). Die Summe der beiden Werte ergibt den sogenannten Gleason-Score, der für Diagnose und Therapieentscheidung eine wichtige Rolle spielt. Ein Gleason-Score von 6 deutet auf ein niedriges Risiko hin, ein Gleason-Score darüber auf mittleres oder hohes Risiko. Spezielle Bedeutung hat der Gleason-Score 7a, der sich aus dem Grad 3 als häufigstem Wachstumsmuster und 4 zusammensetzt (3+4). Er gilt als mittleres Risiko, allerdings mit guter Prognose. Gray (Gy) (Nach dem britischen Physiker Louis Harold Gray) Bezeichnet die Einheit, welche die Strahlendosis angibt.
HIFU
Abkürzung für Hochintensiver fokussierter Ultraschall. Dabei werden sehr stark konzentrierte Ultraschallwellen gezielt auf das Tumorgewebe gelenkt mit dem Ziel, durch die entstehende Wärme die Krebszellen zu zerstören. histologisch Lehre von den biologischen Geweben. Unter dem Mikroskop werden Zellstrukturen untersucht. Für eine gesicherte Krebsdiagnose ist der Nachweis von Tumorgewebe zwingend.
Hormon (siehe Artikel "Hormontherapie (ADT)")
Bezeichnet Stoffe, die bestimmte Vorgänge und Abläufe im Körper regulieren, zum Beispiel: den Stoffwechsel, das Sexualverhalten oder die Anpassung an Angst und Stress.
Hormonentzugstherapie (siehe Artikel "Hormontherapie (ADT)")
Das Wachstum von Prostatakrebs wird durch das männliche Sexualhormon Testosteron begünstigt. Eine Möglichkeit, das Wachstum zu beeinträchtigen und so den Erkrankungsverlauf zu verlangsamen, ist der Entzug von Testosteron. Dies ist mit Medikamenten oder operativ möglich.
Hyperthermie
Überwärmung; in der Medizin bezeichnet man damit eine Behandlung, bei der die Gewebetemperatur künstlich erhöht wird.
Hypofraktionierte Bestrahlung
Bei dieser Bestrahlung erhalten Sie eine Strahlendosis von insgesamt etwa 74 – 80 Gray. Diese Dosis wird auf mehrere Sitzungen verteilt (fraktioniert). In der Regel dauert eine Bestrahlung sieben bis neun Wochen. Es ist aber auch möglich, die Einzeldosis pro Sitzung zu erhöhen, dafür aber die Dauer der Behandlung auf vier bis sechs Wochen zu verkürzen. Dann spricht man von einer hypofraktionierten Bestrahlung. Sie kann kurzfristig zu mehr Nebenwirkungen führen. Dafür ist sie schneller abgeschlossen.
IGeL
Abkürzung für „Individuelle Gesundheitsleistungen“, bezeichnet medizinische Leistungen, die nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Häufig ist der Nutzen solcher Leistungen nicht ausreichend nachgewiesen.
Impotenz
Siehe erektile Dysfunktion.
Inkontinenz
Unfähigkeit, etwas zurückzuhalten. Im Ratgeber werden Harninkontinenz und Stuhlinkontinenz angesprochen.
intern
Von innen.
Intervention
Bezeichnet in der Medizin die aktive Form der Behandlung, zum Beispiel die Operation oder die Bestrahlung. Im Gegensatz dazu stehen die sogenannten defensiven Strategien, die zunächst abwarten und beobachten.
Karzinom
Das Karzinom gehört zu den bösartigen Krebsarten. Das bedeutet: Krebszellen können über die Blut- oder Lymphbahnen in andere Gewebe streuen und dort Absiedelungen bilden. Das Karzinom ist ein vom Deckgewebe (Epithel) ausgehender Tumor.
Kastration
Unterdrückung der Produktion von Geschlechtshormonen im Körper. Das kann durch eine Operation geschehen oder chemisch durch die Gabe von Medikamenten.
Komorbidität
Bezeichnung für Begleiterkrankungen. Zum Beispiel kann ein Prostatakrebspatient gleichzeitig an Diabetes und Bluthochdruck leiden.
Kryotherapie
Arbeitet mit dem gezielten Einsatz von Kälte, um die Krebszellen zu zerstören
kurativ
Mit dem Ziel der Heilung.
laparoskopisch
Die laparoskopische Chirurgie ist ein Teilgebiet der Chirurgie. Durch kleine Schnitte in die Bauchdecke werden ein optisches Instrument und Operationsinstrumente in den Bauchraum eingeführt. Dies wird auch minimalinvasive Chriurgie genannt.
Lymphadenektomie
Operative Entfernung der Lymphknoten. Die entfernten Lymphknoten werden auf Tumorbefall untersucht. So kann festgestellt oder ausgeschlossen werden, dass der Tumor bereits gestreut hat. Dies ist von Bedeutung für die weitere Behandlung.
Lymphknoten
Jedes Organ, also auch die Prostata, produziert eine Zwischengewebsflüssigkeit, die sogenannte Lymphe. Diese wird über Lymphbahnen transportiert und in den Lymphknoten gefiltert.
Magnetresonanztomographie (siehe Artikel "Magnetresonanztomographie (MRT)")
Bildgebendes Verfahren, das zur Diagnostik eingesetzt wird. Von außen können, ähnlich wie bei der Computertomographie (CT), Struktur und Funktion der inneren Gewebe und Organe dargestellt werden. Allerdings beruht dieses Verfahren, anders als Röntgen oder CT, nicht auf Radioaktivität, sondern auf starken elektromagnetischen Feldern.
Metastasen
Bedeutet sinngemäß: die Übersiedlung von einem Ort an einen anderen. Wenn eine Geschwulst entsteht, spricht man vom Primärtumor. Ist dieser Tumor bösartig, so kann er Metastasen bilden, das bedeutet: Einzelne Krebszellen lösen sich vom Primärtumor und wandern durch die Blutbahn an andere Stellen im Körper, um sich dort anzusiedeln.
minimal-invasiv
Eingriffe oder Untersuchungen, die mit möglichst kleinen Verletzungen der Haut und der Weichteile einhergehen („Schlüsselloch-Chirurgie“).
neoadjuvant
Eine unterstützende Behandlung, die bereits vor dem eigentlichen Eingriff durchgeführt wird, also zum Beispiel die Hormongabe vor einer Operation oder Bestrahlung.
negatives Ergebnis und falsch negatives Ergebnis
Von einem negativen Testergebnis spricht man, wenn ein Test keinen Verdacht auf eine Erkrankung (z.B. Krebs) liefert, wenn das Ergebnis also unauffällig ist. Ein falsch negatives Testergebnis ist unauffällig, obwohl tatsächlich ein Tumor vorliegt, das heißt, ein Tumor wurde übersehen.
Neurapraxie
Drucklähmung, vorübergehende Nervenschädigung in den Beinen durch Druck während der Operation.
Nomogramm
Grafische Schaubilder und Modelle, die funktionale Zusammenhänge darstellen, zum Beispiel zwischen den verschiedenen diagnostischen Werten und der Aggressivität des Tumors.
Nuklearmedizin
In der Nuklearmedizin werden offene Radionuklide (radioaktive Stoffe) verwendet, die sich im Körper frei verteilen können. Dies kann durch eine Spritze in die Blutbahn oder durch Tabletten erfolgen, die sich im Magen auflösen. In der Nuklearmedizin erfolgen damit Untersuchungen (zum Beispiel Skelettszintigramm) aber auch Behandlungen (zum Beispiel Radioiodtherapie der Schilddrüse).
Ödem
Krankhafte Ansammlung von Gewebsflüssigkeit in den Zellzwischenräumen.
Onkologie
Fachbezeichnung für den Zweig der Medizin, der sich mit Diagnose, Behandlung und Nachsorge von Krebserkrankungen befasst.
Orchiektomie (siehe Artikel "Hormontherapie (ADT)")
Operative Entfernung der Hoden.
Osteoporose
Krankhafter Schwund des festen Knochengewebes.
palliativ
Lindernd, mit dem Ziel der Linderung, nicht mit dem Ziel der Heilung.
Pathologe
Fachrichtung der Medizin, die sich mit den krankhaften Vorgängen im Körper befasst. Ein Pathologe untersucht zum Beispiel das Gewebe, das bei einer Krebsoperation entnommen wurde, um daraus Rückschlüsse auf Art und Umfang des Tumors zu ziehen.
perineal (siehe Artikel "Prostata-Biopsie")
Der perineale Zugang bei der operativen Entfernung der Prostata ist der Zugangsweg „von unten“ über den Damm.
perkutan
Durch die Haut.
positives Ergebnis und falsch positives Ergebnis
Ein positives Testergebnis weist darauf hin, dass die Krankheit, nach der gesucht wurde, auch tatsächlich vorliegt, es bestätigt also einen Krankheitsverdacht. Ein falsch positives Testergebnis liefert einen Krankheitsnachweis, der sich im Nachhinein als falsch herausstellt, das heißt, es handelt sich um einen „Fehlalarm“.
Prognose
In der Medizin: Vorhersage über den vermuteten Krankheitsverlauf. Progress Fortschreiten der Krebserkrankung durch Tumorwachstum oder Metastasenbildung.
PSA
Das prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein Eiweiß, das nur in der Prostata produziert wird. Im Krebsgewebe ist es zehnmal höher konzentriert als in gesundem Prostatagewebe.
Psychoonkologe
Ein Psychoonkologe behandelt die unter Umständen auftretenden seelischen Auswirkungen einer Krebserkrankung. Psychoonkologen sind speziell weitergebildete Psychologen oder Mediziner.
radikale Prostatektomie (siehe Artikel "Radikale Prostatektomie (RPE)")
Die vollständige operative Entfernung der Prostata.
Radiologie
In der Radiologie kommen bildgebende Verfahren unter Anwendung von Röntgenstrahlen, aber auch Ultraschall und Kernspintomographie zur Untersuchung zum Einsatz. Bei der interventionellen (einschreitenden) Radiologie werden auch Behandlungen vorgenommen. Ein Beispiel hierfür ist die Aufweitung von Gefäßen durch eine Ballondehnung. Unter Röntgenkontrolle wird die enge Stelle im Gefäß gesucht, aber die Aufdehnung der Engstelle erfolgt durch einen Ballon.
Rehabilitation
Wiederbefähigung. Unter Rehabilitation werden alle medizinischen, psychotherapeutischen, sozialen und beruflichen Maßnahmen zusammengefasst, die eine Wiedereingliederung eines Kranken in Familie, Gesellschaft und Berufsleben zum Ziel haben. Diese Maßnahmen sollen es den Patienten ermöglichen, besser mit krankheitsbedingten Problemen fertigzuwerden.
Resektion
Die operative Entfernung von krankem Gewebe.
retropubisch
Der retropubische Zugang bei der operativen Entfernung der Prostata ist der Zugang „von vorn“ durch einen Schnitt in die Bauchdecke oberhalb des Schambeins.
Rezidiv
Das Wiederauftreten (Rückfall) einer Erkrankung.
S3-Leitlinie (siehe Artikel "Patientenleitlinie für Prostatakrebs")
Bei einer Leitlinie handelt es sich um eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe über die angemessene ärztliche Vorgehensweise. Sie wird von einer Expertengruppe im Auftrag einer oder mehrerer wissenschaftlicher medizinischer Fachgesellschaften erstellt. Die Angaben zu Untersuchungen und Behandlungen der beschriebenen Erkrankungen stützen sich auf wissenschaftliche Nachweise. Eine Leitlinie ist aber kein „Kochbuch“ für Ärzte. Jeder Patient hat seine individuelle Krankengeschichte. Das muss die Ärztin oder der Arzt bei der Behandlung berücksichtigen. Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) hat ein Klassifikationsschema entwickelt, wobei S3 die höchste Qualitätsstufe ist. Dazu müssen alle Empfehlungen aus der wissenschaftlichen Literatur abgeleitet und in einem festgelegten Vorgang von allen Experten im Konsens ausgesprochen werden. Die wissenschaftlichen Grundlagen für die Leitlinie sind nach ihrer Qualität zu bewerten und entsprechend zu berücksichtigen. Siehe auch: www.awmf-leitlinien.de.
Seeds
Kleine Strahlungsquellen, die ungefähr die Größe von Saatkörnern haben, werden bei der LDR-Brachytherpaie in die Prostata eingesetzt.
Skelettszintigraphie
Nach der Gabe einer radioaktiven Substanz, die sich im Knochen einlagert, wird mit einer Spezialkamera eine Aufnahme des Skeletts gemacht. So können Veränderungen erkannt werden, die auf einen Tumor im Knochen hindeuten können.
Stanzbiopsie (siehe Artikel "Prostata-Biopsie")
Eine Biopsie ist die Entnahme von Gewebe aus dem lebenden Organismus. Bei einer Stanzbiopsie werden die Gewebeproben mit Hilfe von Hohlnadeln aus dem zu untersuchenden Gewebe „gestanzt“.
Strahlentherapie
Fachgebiet der Medizin, das sich mit der Anwendung von hochenergetischen Strahlen zur Behandlung (Therapie) beschäftigt. Verwendet werden dabei durch Geräte hergestellte Strahlen, die von außen in den Körper eindringen, wie Photonen und Elektronen, in Zukunft auch Protonen und schwere Ionen. Außerdem werden radioaktive Elemente (Radionuklide) zu Behandlungszwecken angewendet, zum Beispiel in Form von Seeds oder beim HDR-Afterloading der Prostata. Hierbei kommen – im Gegensatz zur Nuklearmedizin – nur umschlossene Radionuklide zur Anwendung (abgepackt in eine Umhüllung) supportive Therapie Durch die Krebserkrankung können weitere Beschwerden entstehen, die ebenfalls behandelt werden müssen. Dies geschieht im Rahmen einer supportiven Therapie. Testosteron Männliches Sexualhormon, das dafür sorgt, dass Prostatazellen schneller wachsen und sich vermehren. Das gilt besonders für Prostatakrebszellen. Wenn der Testosteronspiegel gesenkt wird, verlangsamt sich das Wachstum der Krebszellen, und nur noch wenige teilen sich.
Therapie
Behandlung, Heilbehandlung.
transrektal
Durch den Enddarm.
Tumor
Geschwulst.
Tumorstadium
Das Tumorstadium zeigt an, wie weit die Tumorerkrankung fortgeschritten ist. Die Einteilung der Erkrankungsstadien richtet sich nach der Größe des Tumors (Kurzbezeichnung: T), ob Lymphknoten befallen sind (Kurzbezeichnung: N) und ob der Tumor sich in anderen Organen angesiedelt (Metastasen gebildet) hat (Kurzbezeichnung: M).
Ultraschall
Schallwellen, die oberhalb des vom Menschen wahrnehmbaren Frequenzbereichs liegen. Diese Schallwellen können zur Bildgebung genutzt werden. Ultraschallwellen sind nicht elektromagnetisch (radioaktiv).
Urologie
Die medizinische Fachrichtung hat die harnbildenden und harnableitenden Organe des Menschen und die männlichen Geschlechtsorgane zum Gegenstand.
Selbsthilfegruppe
Anlaufstelle für Betroffene und Nahestehende, um sich über ein gemeinsames Schicksal auszutauschen; in Österreich prostatakrebse.at; in Deutschland prostata-hilfe-deutschland.de
Citizen Science
Toiletten finden mittels App? Möglich dank Citizen Science!
Das Kernprinzip von PATIOSpots ist Citizen Science. Dieser Ansatz, auch Bürgerwissenschaft genannt, bezieht die Bevölkerung, in unserem Fall Prostatakrebs-Patienten und ihre Bezugspersonen, auf Augenhöhe in wissenschaftliche Projekte ein. Dieser Forschungsansatz bietet die einzigartige Möglichkeit, Bürger:innen direkt an Citizen-Science-Projekten teilnehmen zu lassen und somit in unserem Fall unmittelbar an der Verbesserung des Lebensalltags mit Krebs beizusteuern.
Konkrete Beispiele, wie Du als Einzelperson mitmachen kannst, sind:
- die Sammlung von Daten: Nutzer:innen können bei der Sammlung von Daten für wissenschaftliche Studien helfen, indem sie z.B. Erfahrungen mit Toiletten, Behandlungszentren, Ärztinnen- und Arztpraxen und sozialen Räumen in einem bestimmten Gebiet machen und diese Daten per App online teilen.
- die Analyse von Daten: Nutzer:innen können bei der Analyse von Daten helfen, indem sie etwa Bilder der Toiletten hochladen, ihre Sauberkeit bewerten und sie mittels Punktesystem kategorisieren und darauf basierend eine Empfehlung aussprechen oder davon abraten.
- das Einbringen von Ideen und Feedback: Nutzer:innen können Veränderungen bewirken, indem sie z.B. besonders unhygienische Toiletten identifizieren oder die Notwendigkeit weiterer Toiletten in bestimmten Gebieten feststellen. Sie können auf diesem Weg öffentliche Diskussionen anregen und Feedback an betreffende Stadträte abgeben und so dazu beitragen, dass wissenschaftliche Ergebnisse und Erfahrungen des täglichen Lebens auf eine breitere Bevölkerung übertragen werden.
Citizen Science bietet Bürger:innen also die Möglichkeit, direkt an wissenschaftlichen Prozessen teilzunehmen und sich so an der Veränderung wichtiger gesellschaftlicher Angelegenheiten zu beteiligen.
Möchtest auch Du deinen Beitrag leisten und von den Erfahrungen anderer profitieren? Dann brauchst Du damit nicht länger warten, lade dir jetzt unsere App “PATIOSpots” herunter!
Diese Website verwendet keine externen Trackers, keine Analytics, nur Session-Cookies und sie respektiert deine Privatsphäre.